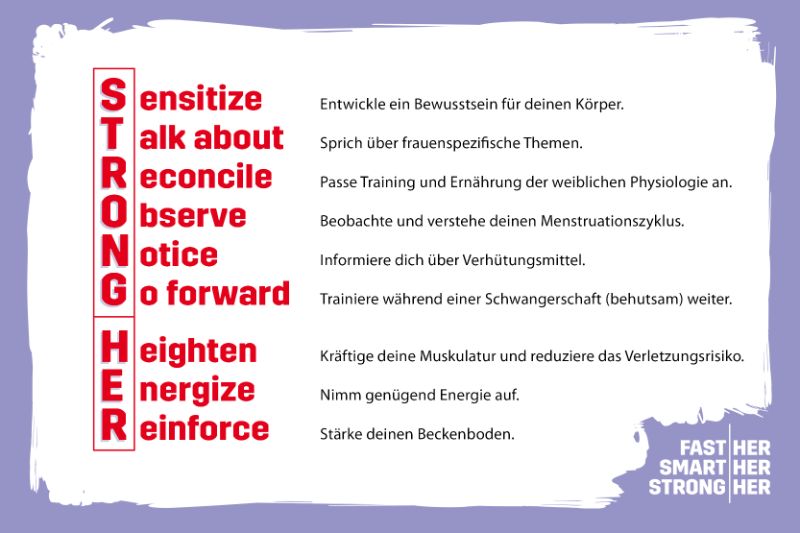Zwei Drittel der sportwissenschaftlichen Studien (Stand: 2022) befassen sich bei ihren Untersuchungen ausschliesslich mit Männern. Entsprechend fehlt nötiges und wichtiges Fachwissen, wie Athletinnen sportlich optimal gefördert und betreut werden sollen. Frauenspezifische Themen wie Menstruationszyklus oder Schwangerschaft sind noch immer «Tabuthemen». Umfassendes Wissen darüber ist jedoch von zentraler Bedeutung, um das Training und die Leistungsfähigkeit einer Athletin zu optimieren. Nachfolgend findest du wichtige Informationen und weiterführende Links zu denjenigen frauenspezifischen Themen, die das Projekt «Frau und Spitzensport» in den Fokus rückt.
Frau und Spitzensport
Frauenspezifische Themen wie der Menstruationszyklus, Schwangerschaften, das relative Energiedefizit-Syndrom (REDs) oder der Beckenboden werden im Spitzensport viel zu wenig thematisiert und diskutiert. Mit dem Projekt «Frau und Spitzensport» will Swiss Olympic die Voraussetzungen für Frauen im Spitzensport nachhaltig verbessern und die Thematik in der Spitzensportförderung der Schweiz etablieren.
Früh erkennen. Richtig handeln. Sicher zurück!
Viele Athletinnen haben ein erhöhtes Risiko, eine Gehirnerschütterung im Sport (auf Englisch Sports-Related Concussion SRC) zu erleiden und erleben andere Verläufe als ihre männlichen Kollegen. Wer schnell reagiert, bei Hinweisen auf eine Gehirnerschütterung sofort den Sport unterbricht und sich am Sportfeldrand oder ausserhalb der Piste untersuchen lässt, kann die Erholungszeit verkürzen.





Was ist bei Athletinnen anders als bei ihren männlichen Kollegen?
Als Athletin bist du besonders gefährdet, eine Gehirnerschütterung im Sport zu erleiden. Die Ergebnisse von Studien sind nicht einheitlich, jedoch zeigt die Mehrzahl von Studien, dass Frauen in vergleichbaren Sportarten und Leistungsniveaus häufiger eine Gehirnerschütterung erleiden als Männer - mit je nach Sport und Level unterschiedlich grossem Unterschied – und dass ihre Symptome im Durchschnitt länger anhalten.
Das hat verschiedene Gründe:
Biomechanik und Nackenmuskulatur
Frauen haben im Mittel weniger Kraft in der Nackenmuskulatur. Bei plötzlichen Bewegungen wird der Kopf daher weniger wirksam stabilisiert, was zu grösseren Kopfbeschleunigungen und damit zu höherer Belastung des Gehirns führen kann.
Einfluss hormoneller Schwankungen
- In der zweiten Zyklushälfte, der sogenannten Lutealphase, ist das Progesteron zunächst erhöht und fällt erst gegen Ende dieser Phase deutlich ab. Dieses Hormon wirkt im Gehirn unter anderem gefässschützend und entzündungshemmend. Wenn eine Gehirnerschütterung in der späten Lutealphase auftritt, können durch den gleichzeitigen Progesteronabfall die Symptome intensiver ausfallen und die Erholung länger dauern– das ist eine gut begründete, aber noch nicht einheitlich bestätigte Beobachtung.
- Nach einer Gehirnerschütterung sind Zyklusveränderungen zudem nicht selten. Rund ein Viertel der betroffenen Frauen berichten in den Folgemonaten über mindestens zwei untypische Zyklen, zum Beispiel ein Ausbleiben der Menstruation oder eine deutliche Verkürzung. Solche Veränderungen können ein Hinweis darauf sein, dass die hormonelle Regulation noch vorübergehend gestört ist. Sie sind jedoch kein Beweis dafür, dass die Erholung ausbleibt.
- Deshalb lohnt es sich nach einer Gehirnerschütterung, Symptome und Zyklusverlauf zu dokumentieren und Auffälligkeiten mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt zu besprechen. Wenn Beschwerden deutlich zunehmen, neue starke Symptome auftreten oder der Zyklus mehrfach aus dem Rahmen fällt, sollte eine spezialärztliche Untersuchung durch eine Fachärztin oder einen Facharzt Neurologie mit Erfahrung in der Diagnostik von Gehirnerschütterungen bzw. durch eine in der neurologischen Untersuchung und Beurteilung erfahrene Fachärztin oder Facharzt erfolgen.
Neben diesen biologischen Faktoren spielt auch der psychosoziale Druck eine grosse Rolle. Viele Athlet*innen stehen im Spitzensport im Spannungsfeld zwischen Training, Wettkampf, Ausbildung oder Beruf. Dieser Druck kann dazu führen, dass Symptome heruntergespielt oder verschwiegen werden – in Studien assoziiert mit längerer Erholung und anhaltenden Beschwerden.
In unserem Factbook findest du weitere Infos zum Thema.
Downloads
Wie beeinflusst der weibliche Zyklus die Leistung der Athletin?
Mehr als die Hälfte der Athletinnen spürt einen Einfluss des Zyklus auf die Leistung in Training und Wettkampf. Es kann sinnvoll sein, das Training und die Auswirkungen des Zyklus aufeinander abzustimmen. Wertvolle Informationen und Tipps zur Thematik dazu findest du beispielsweise in der Infografik Zyklus sowie in Referaten des Trainers Adrian Rothenbühler zu zyklusgesteuertem Training.
Wusstest du zudem, dass die Art der Verhütung einen Einfluss auf den Zyklus hat? Eine hormonelle Verhütung (z.B. durch die Pille) kann beispielweise die Auswirkungen des Zyklus beeinflussen. Mehr Informationen hierzu findest du im Fokusthema «Verhütungsmittel».
Welche Beispiele aus der Praxis gibt es zu zyklusgesteuertem Training?
Ein Beispiel, wie das zyklusorientierte Training in der Praxis aussehen kann, zeigt der Schweizerische Fussballverband (SFV). Dieser hat den Zyklus – sowohl bei der 1. Mannschaft wie auch beim Nachwuchs – in den Trainingsalltag integriert. In unserer Übersichtsgrafik ist dargestellt, was der SFV pro Zyklus-Phase in den Bereichen «Activation», «Regeneration» und «Nutrition» unternimmt. Die Grafik verlinkt auch auf weiterführende Materialien, wie zu den Zyklusphasen passende Trainings-Übungen oder Smoothie-Rezepten. Die Materialien basieren auf den Erfahrungswerten und Quellen des SFV.
Downloads zum Thema Zyklus
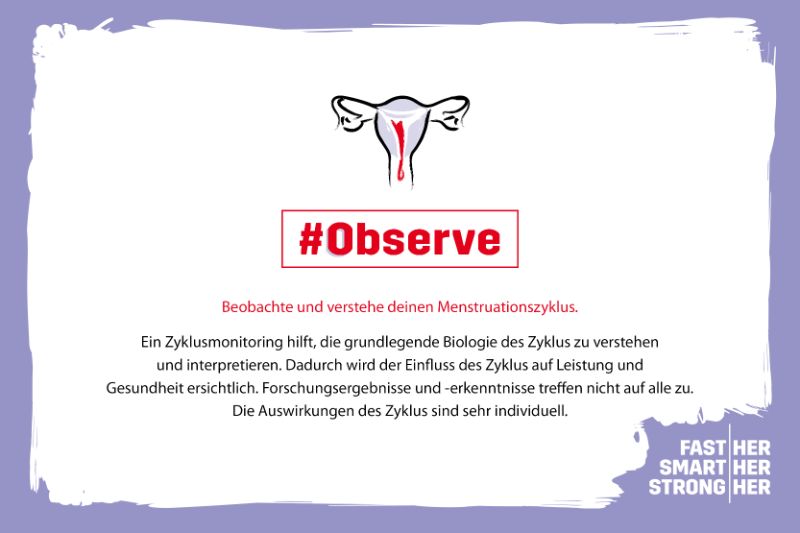
Was sind Verhütungsmittel und wozu dienen sie?
Verhütungsmittel, auch genannt Kontrazeptiva, können zur Verhütung, zur Regulierung des Zyklus oder zur Reduktion von Menstruationsbeschwerden in unterschiedlichen Formen angewendet werden. Es wird zwischen Verhütungsmitteln mit und ohne Hormone unterschieden. Je nach Verhütungsmittel ist ein zyklusabhängiges Training möglich oder nicht. Swiss Olympic hat in Zusammenarbeit mit Fachpersonen ein interaktives Flowchart erarbeitet, das Unterstützung bietet. Das Gespräch mit einer gynäkologischen Fachperson ist in jedem Fall notwendig und hilfreich.
Was muss ich bei der Wahl des Verhütungsmittels beachten?
Die Auswahl an Verhütungsmitteln ist gross, entsprechend ist es wichtig, vor der Wahl die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Produkte im Zusammenhang mit der eigenen Gesundheit und dem Zyklus zu analysieren um eine möglichst passende Lösung zu finden.
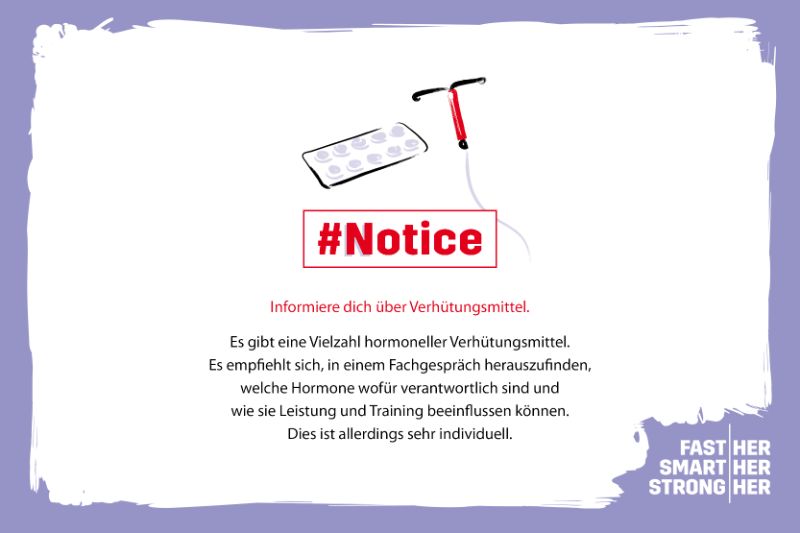
Was passiert, wenn Körper und Wille Leistung fordern, aber die Seele nicht mehr kann?
Der kurze Dokumentarfilm «The Resilience Run» erzählt die Geschichte von Coralie Ambrosini, die als junge Leichtathletin im Leistungssport an einer Essstörung und Depression erkrankte. Offen und eindrücklich zeigt der Film den schwierigen Weg zur Diagnose, die Rolle von Therapie und Umfeld – und wie der Sport schliesslich Teil der Heilung wird.
Die Doku ist Teil des Projekts «Frau und Spitzensport» und bricht das Tabu rund um psychische Erkrankungen im Leistungs- und Spitzensport. Sie macht zudem auf das Relative Energiedefizit-Syndrom (REDs) aufmerksam – ein Zustand, bei dem die Energiezufuhr den Bedarf des Körpers über längere Zeit nicht deckt. «REDs ist ein ernstzunehmendes Signal des Körpers, das wir im System Leistungssport besser verstehen, begleiten und verhindern müssen», so Ewa Haldemann, Projektleiterin «Frau und Spitzensport» bei Swiss Olympic.
Was ist das relative Energiedefizit-Syndrom (REDs) und was bedeutet es für eine Athletin?
In einigen Sportarten schränken Athlet*innen ihre Energiezufuhr ein, um eine bessere Leistung zu erbringen. Nimmt eine Athletin zu wenig Energie auf, drohen gesundheitliche Risiken wie eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit, Zyklusstörungen, Leistungseinbussen oder eine geringere Knochendichte. Leidet eine Athlet*in an solchen Folgen, spricht man vom Relativen Energie-Defizit Syndrom (REDs).
Weshalb ist Energiemanagement für Athletinnen so wichtig?
Um REDs vorzubeugen, ist ein gutes Energiemanagement zentral. Als Athletin brauchst du genügend Energie – nicht nur für dein Training, sondern auch für alle wichtigen Körperfunktionen. Wird dein Energiebedarf über längere Zeit nicht gedeckt, bringt das deine hormonelle Balance, Regeneration und Leistungsfähigkeit aus dem Gleichgewicht.
Unser Factbook Energiemanagement zeigt dir, worauf es ankommt, wie du Warnsignale erkennst – und was du aktiv tun kannst, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.
Wann ist eine Gewichtsreduktion sinnvoll – und wie gelingt sie sicher?
In vielen Sportarten spielt das Gewicht eine Rolle – doch eine unbegleitete Gewichtsreduktion birgt gesundheitliche Risiken, besonders bei jungen Athletinnen. Eine Reduktion muss individuell, geplant und begleitet erfolgen. Ohne professionelle Unterstützung steigt das Risiko für Unterversorgung, Verletzungen oder sogar Essstörungen.
Im Factbook Gewichtsmanagement erfährst du, wann eine Reduktion überhaupt sinnvoll ist, wie du sie sicher planst und warum professionelle Unterstützung dabei so wichtig ist.
Downloads zum Thema REDs/Ernährung
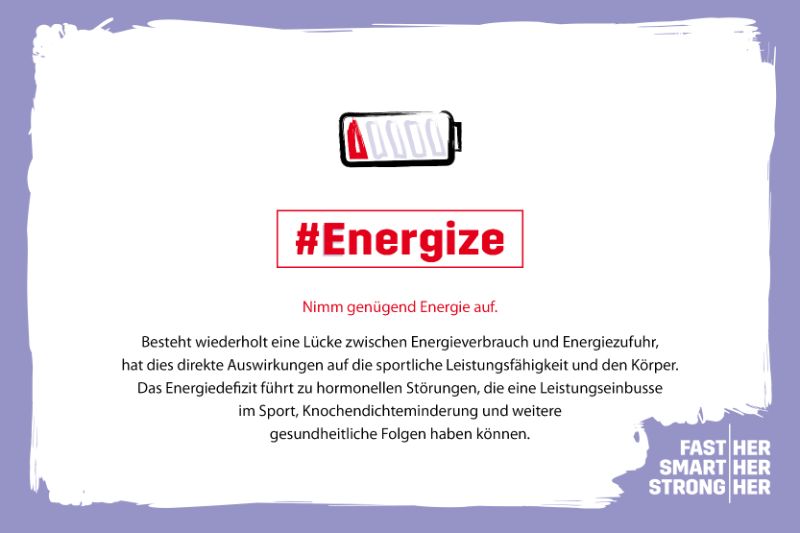
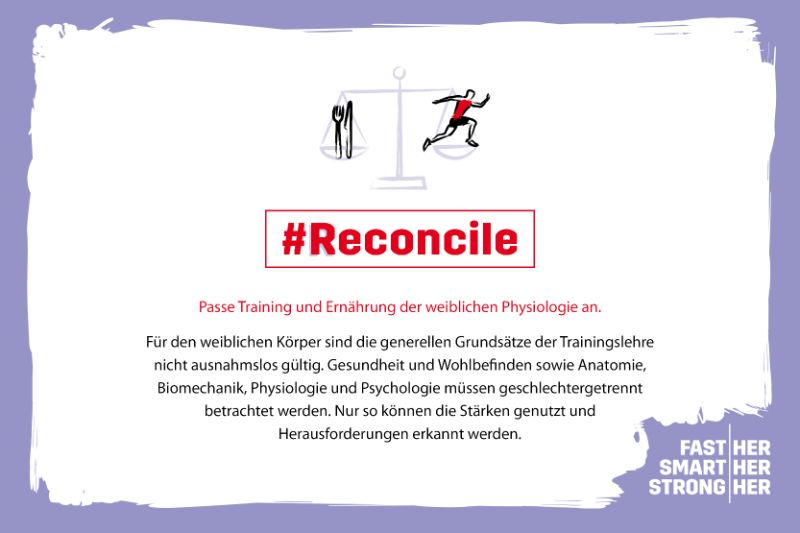
Was muss ich als Athletin über das Training während und nach der Schwangerschaft wissen?
Während einer Schwangerschaft verändert sich nicht nur das Aussehen, sondern auch Stoffwechselabläufe und andere Körperfunktionen. Die Athletin soll während einer komplikationsfreien Schwangerschaft weiter trainieren, da sich dies positiv auf Mutter und Kind auswirkt. Beachtet die Athletin während und nach der Schwangerschaft einige Tipps, kann sie gewisse Probleme und Risiken vermeiden.
Welche Unterstützungsleistungen kann ich als schwangere Athletin von Verband und Sponsoren erwarten?
Für selbständig erwerbende Athletinnen sind die allgemeinen, gesetzlichen Grundlagen für angestellte Mannschaftssportlerinnen nicht gültig. Es empfiehlt sich somit sich gut über Themen wie Gesundheitsschutz, Mutterschaftsurlaub und -entschädigung sowie Familienzulagen zu informieren. Dies gilt auch für Verbände und Sponsoren, die mit einer selbständig erwerbenden Athletin zusammenarbeiten.
Downloads zum Thema Schwangerschaft
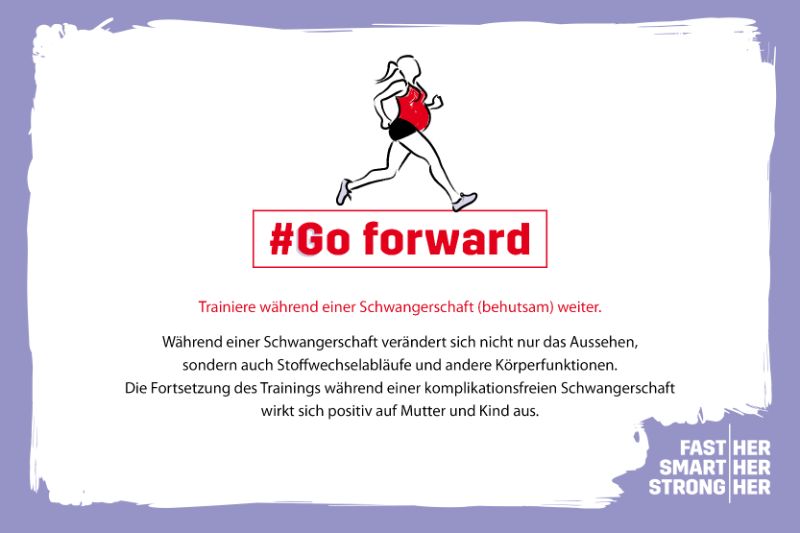
Wie stärke ich als Athletin meinen Beckenboden und beuge Dysfunktionen vor?
Rund sechs von zehn Athletinnen sind von sogenannten Beckenboden-Dysfunktionen betroffen. Der Beckenboden schliesst das Becken gegen unten ab und stützt die inneren Organe. Er kann willentlich angespannt und entspannt werden und ist deshalb – wie ein Muskel – trainierbar. Erzeugt der Beckenboden zu viel oder zu wenig Spannung, kann dies zu ungewollten Effekten wie etwa Belastungsinkontinenz und Schmerzen führen.
Wie hängt der Beckenboden mit dem Thema Sexualität zusammen?
Der Beckenboden spielt nicht nur im Sport, sondern auch in der Sexualität eine grosse Rolle – insbesondere hat er einen grossen Einfluss darauf, ob und wie sehr wir Sex und die Zeit danach geniessen können.
In der Sexualität stossen wir vor allem bei chronisch angespanntem Beckenboden an unsere Grenzen. Die Folgen davon können von Schmerzen bis hin zur Blasenentzündung reichen – Symptome, die das Wohlbefinden im Alltag sowie auch beim Sport stark beeinflussen.
Mit diversen Übungen kann der Beckenboden jedoch trainiert werden – sowohl im Alltag wie auch beim Sex. Swiss Olympic hat dazu in Zusammenarbeit mit dem BASPO diverse Übungen zusammengestellt, unter anderen zum Thema Atmung, zum Erkennen und Entgegenwirken bei einer chronisch angespannten Beckenboden-Muskulatur und zum Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung.
Nachfolgend findest du ein Übungs-Beispiel. Weitere Übungen sind in dieser Playlist zu finden.
Downloads zum Thema Beckenboden

Warum ist es wichtig, sich Gedanken zu seiner Knochengesundheit zu machen?
Knochengesundheit ist wichtig für die sportliche Leistungsfähigkeit. Gerade Athletinnen sind häufig von Problemen wie einer tieferen Knochendichte betroffen. Im Sport äussert sich eine tiefe Knochendichte oft als Stressfraktur (=Ermüdungsbruch). Dies ist eine gravierende Verletzung, die oft einen Trainingsausfall von mehr als zwei Monaten zur Folge hat. Am häufigsten treten Stressfrakturen bei Athletinnen der Sportarten Mittel- und Langstreckenlauf, Gymnastik und Leichtathletik auf.
Prüfe mit unserem Factsheet, inklusive Checkliste, ob du die Faktoren für eine gute Knochengesundheit erfüllst und wie du gezielt Problemen vorbeugen kannst.
Downloads zum Thema Knochengesundheit

Welche Aspekte gilt es für Sportlerinnen beim Thema Brustgesundheit zu beachten?
Regelmässige sportliche Aktivität stellt besondere Anforderungen an den Körper, insbesondere an die Brust. Brustschmerzen, Unbehagen und Verletzungen können nicht nur das Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch die sportliche Leistung mindern. Deshalb ist es wichtig, sich intensiv mit der Brustgesundheit zu beschäftigen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
Etwa ein Drittel aller Athletinnen verspürt Brustschmerzen während des Sports. Ein gutsitzender Sport-BH kann diese Beschwerden lindern und die Leistung steigern. Je nach Intensität deiner sportlichen Aktivitäten sollte die Stützfunktion des Sport-BHs entsprechend gewählt werden. Dabei gilt:
- Je intensiver und häufiger die Bewegungen der Sportaktivität, desto stärker sollte die Stützfunktion des Sport-BH sein. Ein zu wenig stützender BH kann zu Schmerzen und Verletzungen führen.
- Durch einen passenden Sport-BH können zudem hormonell bedingte Zyklusbeschwerden reduziert werden.
Mehr Informationen dazu findest du in unserem Factsheet zum Thema Brustgesundheit.
Downloads zum Thema Brustgesundheit
Was muss ich als Athletin über die Pubertät wissen? Weshalb ist sie so wichtig?
In der Pubertät verändern sich Körper und Psyche von Athlet*innen stark, denn der Körper entwickelt sich vom Kind zum Erwachsenen. Diese Veränderung ist für alle herausfordernd – für Athletinnen kann die Pubertät jedoch besonders schwierig sein. Swiss Olympic hat deshalb eine interaktive Übersicht erarbeitet. Diese zeigt dir auf, was sich während der Pubertät verändert, wie du damit umgehen kannst und wo du weitere Infos findest. Das Wichtigste vorneweg: Mach dir keine Sorgen – all diese Veränderungen sind normal und wichtig! Lass dich dadurch nicht beunruhigen oder verunsichern.
Downloads zum Thema Pubertät